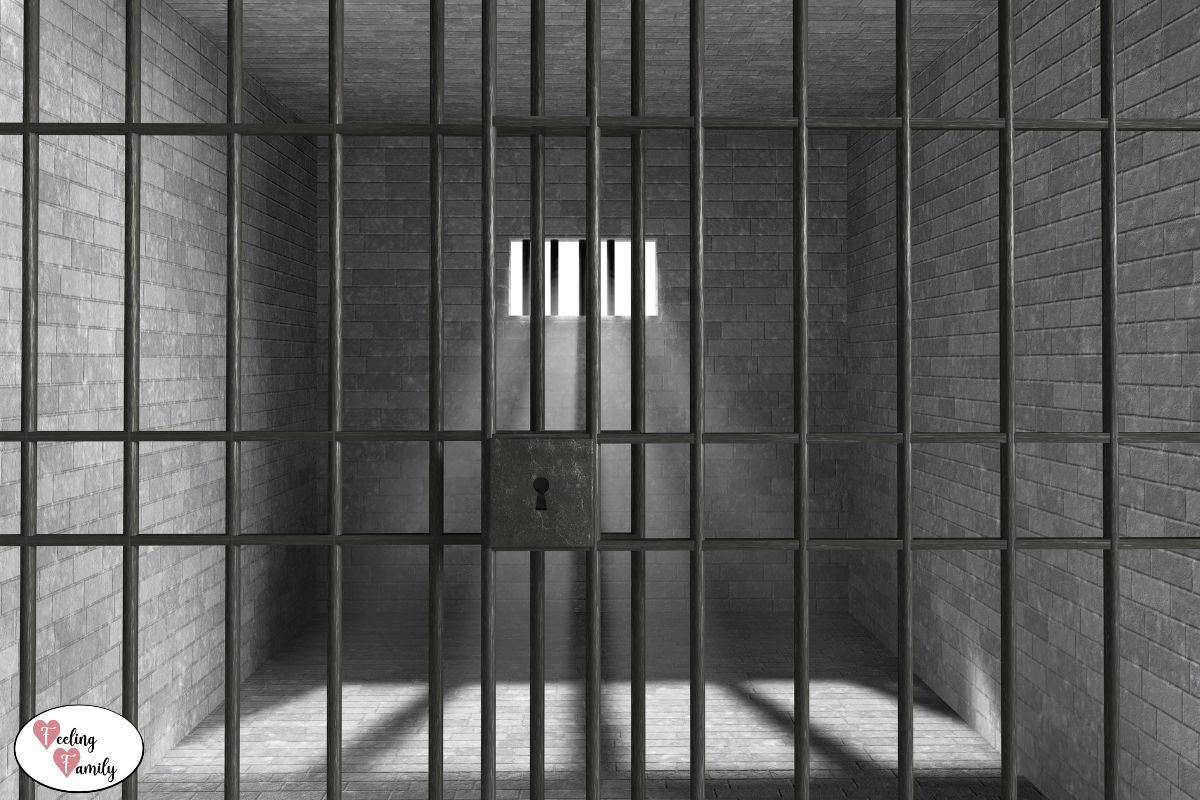Wie beurteilst du ein Kind, das schlägt, schreit, andere ausgrenzt oder seine Macht ausnutzt?
Viele Erwachsene haben – oft unbewusst – ein Bild im Kopf, das sagt:
„Wenn man Kinder nicht früh genug bremst, werden sie egoistisch, rücksichtslos und gefährlich.“
Dieses Menschenbild kommt nicht nur aus unserer eigenen Kindheit oder aus gesellschaftlichen Normen. Es wurde auch von psychologischen Experimenten geprägt, die bis heute in Lehrbüchern stehen – allen voran vom berühmten Stanford-Prison-Experiment.
Lange Zeit galt es als Beweis dafür, dass „ganz normale“ Menschen unter Macht automatisch brutal werden. Und wenn das schon für Erwachsene gilt, dann – so die naheliegende pädagogische Schlussfolgerung – müssen Kinder möglichst früh „sozialisiert“ und kontrolliert werden, damit ihr „innerer Wolf“ nicht ausbricht.
Doch was, wenn die Geschichte ganz anders ist?
Was, wenn dieses Experiment manipuliert war – und uns seit Jahrzehnten ein verzerrtes Bild vom Menschen und damit auch von Kindern verkauft?
In diesem Artikel zeige ich dir:
-
wie das Stanford-Experiment unser Bild von Kindern und Pädagogik beeinflusst hat,
-
warum viele seiner Schlussfolgerungen wissenschaftlich nicht haltbar sind,
-
welche neueren Studien ein deutlich menschlicheres, kooperatives Menschenbild stützen
-
und wie ein humanistischer, bindungsorientierter Blick – zum Beispiel in der Gewaltfreien Kommunikation – deinen Umgang mit Kindern grundlegend verändern kann.
Was sagt das berühmte Stanford-Experiment über uns Menschen?
Hast du schon mal vom berühmten Stanford-Experiment gehört?
Hier kommt die offizielle Version, die maßgeblich das allgemeine Verständnis über das Wesen des Menschen geprägt hat:
„Wie verhalten sich Menschen, wenn man ihnen Macht gibt?“
Das war eine Frage, die sich Forscher nach den Gräueln des Naziregimes stellten.
Um das herauszufinden, plante der Psychologe Philip Zimbardo ein Experiment an der Stanford University, das die Teilnehmer in Gefangene und Wärter aufteilen sollte. Die Gefangenen sollten in einer simulierten Gefängnisumgebung leben, während die Wärter für ihre Überwachung und Kontrolle verantwortlich waren.
Soweit so gut, aber es gab einen Haken: Die Forscher hatten nicht genug „echte“ Gefangene und Wärter, um das Experiment durchzuführen. Also beschlossen sie, die Teilnehmer aus Studenten auszuwählen, die sich freiwillig gemeldet hatten.
Die Forscher sagten den Teilnehmern, dass das Experiment zwei Wochen dauern würde und zahlten ihnen 15 Dollar pro Tag.
Also wurden die Studenten in eine simulierte Gefängnisumgebung gesteckt, komplett mit Zellen und einem Wachraum. Die Wärter trugen dunkle Sonnenbrillen und Uniformen, um ihre Autorität zu betonen, während die Gefangenen nummerierte Kleidung und Fußfesseln trugen. Die Forscher beobachteten das Experiment durch Überwachungskameras und dokumentierten das Verhalten der Teilnehmer.
Das Experiment sollte zeigen, wie Macht und Autorität das menschliche Verhalten beeinflussen können.
Aber was passierte tatsächlich?
Die Wärter begannen – laut offizieller Erzählung – ihre Macht zu missbrauchen und die Gefangenen zu erniedrigen und zu misshandeln. Einige Gefangene zeigten Anzeichen von psychischen Problemen und mussten vorzeitig aus dem Experiment aussteigen. Die Forscher waren angeblich schockiert über das Verhalten der Teilnehmer und brachen das Experiment vorzeitig ab.
Das Stanford-Experiment wurde berühmt und diente als Beispiel dafür, wie Macht und Autorität das menschliche Verhalten beeinflussen können.
Wie gesagt: Das ist die offizielle Version, wie sie auch heute noch in vielen Lehrbüchern steht.
Die Originalseite zum Experiment findest du hier:
👉 https://www.prisonexp.org
Vom Experiment zum düsteren Menschenbild
Diese Erzählung prägte ein eher negativ gefärbtes Menschenbild – und sie beeinflusste auch die Pädagogik.
Kinder mussten also lernen, sich „sozial zu verhalten“, denn im Menschen lauerte angeblich eine ständige Bereitschaft zu Gewalt und Machtmissbrauch.
Frei nach dem Philosophen und Staatstheoretiker Thomas Hobbes, der behauptete:
„Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.“
Kinder wurden – einmal mehr – zu Objekten gemacht, die diszipliniert, kontrolliert und „zivilisiert“ werden müssen, damit die vermeintlich dunkle Natur des Menschen gebändigt wird.
Wie das Stanford-Experiment Lehre und Pädagogik prägte
Das Stanford-Experiment blieb nicht einfach nur eine skurrile Episode der Psychologiegeschichte, sondern prägte ganz konkret, wie über Menschen – und damit auch über Kinder – gesprochen und gelehrt wurde.
Bis heute wird es in vielen Einführungslehrbüchern der Psychologie ausführlich dargestellt und oft ohne große Einordnung als Paradebeispiel dafür genutzt, dass „ganz normale“ Menschen unter bestimmten Bedingungen zu Tätern werden. In Analysen von Lehrbüchern wird immer wieder beschrieben, dass das Experiment sehr häufig vorkommt, während seine methodischen Schwächen und die massiven Manipulationen oft nur am Rand erwähnt werden.
Fachgesellschaften wie die British Psychological Society weisen darauf hin, dass das Stanford-Experiment regelmäßig als Beispiel genutzt wird, um moderne Gräueltaten zu erklären. Es taucht im Unterricht zu Sozialpsychologie, aber auch in Bereichen wie Wirtschaftsethik und Management auf. Dort soll es zeigen, wie leicht Menschen sich Autorität beugen und moralische Grenzen überschreiten.
So verfestigt sich quer durch verschiedene Ausbildungswege die Vorstellung, dass Rolle und Situation ausreichen, um Menschen schnell brutal werden zu lassen – ein Bild, das sich leicht auf Kinder überträgt:
Wenn Menschen von Natur aus gefährlich sind, müssen Kinder möglichst früh „richtig“ geformt und kontrolliert werden.
Medienberichte und populärwissenschaftliche Bücher haben dieses Narrativ zusätzlich verstärkt, indem sie das Experiment als „eine der berühmtesten psychologischen Studien aller Zeiten“ feiern. Geschichten von Macht, Unterdrückung und Aggression bekommen mehr Aufmerksamkeit als Geschichten über Kooperation und Mitgefühl.
Damit wurde das Stanford-Experiment zu einem kulturellen Bezugspunkt für ein pessimistisches, misstrauisches Menschenbild – und damit auch für eine Pädagogik, die eher auf Kontrolle setzt als auf Vertrauen.
Was am Stanford-Experiment nie erzählt wurde
Doch stimmte die Geschichte um das Stanford-Experiment wirklich so, wie sie beschrieben wird?
Obwohl das Experiment in der akademischen Welt schnell bekannt wurde, wurde es auch früh kritisiert. Einige bemängelten, dass das Experiment unethisch war und dass die Teilnehmer nicht ausreichend geschützt wurden. Andere argumentierten, dass das Experiment methodisch fehlerhaft war, da die Teilnehmer sich bewusst waren, dass sie Teil eines Experiments waren und möglicherweise ihr Verhalten anpassten.
Im Jahr 2018 deckte der amerikanische Autor und Dokumentarfilmer Ben Blum in seinem Buch Ranger Games weitere Details auf. Er wertete dafür Interviews, Tonaufnahmen und Dokumente aus und kam zu dem Schluss: Die zentrale „Spontaneität“ des Experiments war in Wirklichkeit stark inszeniert.
Besonders deutlich wird das an einem der wichtigsten Wärter des Experiments, Dave Eshelman. Er berichtete später, er habe sich bewusst an Filmklischees von brutalen Gefängniswärtern orientiert – und er habe verstanden, dass genau dieses Verhalten von ihm erwartet wurde. Zimbardo selbst ermutigte ihn, „härter“ zu sein und das Verhalten der anderen Wärter mit zu beeinflussen.
Philip Zimbardo war außerdem nicht der neutrale Experimentleiter, der er hätte sein müssen. Er war selbst Teil des Experiments, indem er die Rolle des Gefängnisdirektors übernahm. In dieser Rolle forderte er die Wärter wiederholt auf, „durchzugreifen“ und die Gefangenen „unter Kontrolle zu bringen“.
Ein anderer Wärter, Carlo Prescott, berichtete später, dass viele der eingesetzten „Strafmaßnahmen“ aus seinen eigenen Erfahrungen im realen Gefängnis stammten – und dass die Forscher diese bewusst aufgriffen und verstärkten. Es war also keineswegs so, dass ganz gewöhnliche Studenten „aus dem Nichts“ sadistisch wurden. Sie wurden in eine Rolle hineingedrängt, in der bestimmte Verhaltensweisen ausdrücklich erwünscht waren.
Zimbardo selbst formulierte eine Woche vor Beginn des Experiments vor den Wärtern sinngemäß:
Wir werden ihnen ihre Individualität nehmen. Sie werden Uniformen tragen, nur mit Nummern angesprochen und dadurch ein Gefühl der Machtlosigkeit entwickeln.
Die Enthüllungen von Ben Blum und anderen Wissenschaftsjournalist:innen werfen ein neues Licht auf das Stanford-Experiment und stellen die Validität der Ergebnisse grundlegend in Frage.
Die vermeintlich neutrale Frage „Was machen Menschen mit Macht?“ wurde in der Durchführung massiv gelenkt – hin zu einer Antwort, die Zimbardos Theorie bestätigte.
Wissenschaftlich seriös ist das nicht.
Und trotzdem hat genau dieses Experiment, das als eines der berühmtesten der Psychologie gilt, unser Menschenbild nachhaltig beeinflusst.
Ein anderes Bild vom Menschen: Was aktuelle Forschung zeigt
Es gibt viele andere Studien und Experimente, die zu ganz anderen Ergebnissen kamen.
Und wenn wir heute auf die Forschung schauen, wird deutlich: Das düstere Menschenbild, das aus dem Stanford-Experiment abgeleitet wurde („Wenn man Menschen Macht gibt, werden sie zwangsläufig grausam“), lässt sich so nicht mehr halten.
Zum einen haben neuere Analysen des Originalmaterials gezeigt, dass das Experiment stark von den Erwartungen und Anweisungen der Versuchsleiter geprägt war. Historiker wie Thibault Le Texier werteten Tonbandaufnahmen und Unterlagen aus und zeigten, wie stark Zimbardo das Verhalten der Wärter beeinflusste. Die angeblich spontane Brutalisierung war in großen Teilen das Ergebnis von Instruktionen, Rollenvorgaben und einer sehr selektiven Darstellung der dramatischsten Szenen.
Zum anderen zeigen andere Experimente, dass Gruppen unter ungleichen Machtverhältnissen nicht automatisch in Tyrannei kippen. Entscheidend ist, ob Menschen sich mit dieser Rolle identifizieren, welche Werte vermittelt werden und welche Form von Führung modelliert wird.
Große aktuelle Studien zu Kooperation und Hilfsbereitschaft zeichnen ein deutlich komplexeres Bild von uns Menschen. In internationalen Forschungsprojekten konnten Forscher:innen zum Beispiel zeigen, dass Menschen weltweit erstaunlich oft kooperativ handeln, selbst wenn sie dafür kurzfristig Nachteile haben. Prosociales Verhalten – also freiwilliges Helfen, Teilen, Spenden – ist in vielen Kulturen eher die Regel als die Ausnahme.
Besonders spannend: Es gibt Hinweise darauf, dass unser Menschenbild selber unser Verhalten beeinflusst. Menschen, die davon ausgehen, dass andere grundsätzlich egoistisch und gefährlich sind, zeigen weniger Vertrauen und weniger kooperatives Verhalten. Wer dagegen an eine eher „altruistische“ menschliche Natur glaubt, ist eher bereit zu helfen, zu teilen und sich solidarisch zu verhalten.
Das bedeutet:
Wenn wir Menschen grundsätzlich als gefährlich und gewalttätig sehen, fördern wir genau dieses misstrauische Verhalten.
Wenn wir Menschen als grundsätzlich beziehungsfähig und kooperationsbereit sehen (mit all ihren Verletzungen und Triggern), stärken wir diese Seite.
Aus dieser Perspektive kippt das alte, von Zimbardo befeuerte Narrativ:
Nicht „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ ist die ganze Wahrheit, sondern: Menschen sind hochsoziale Wesen, die unter passenden Bedingungen erstaunlich viel Mitgefühl, Mut und Fürsorge zeigen.
Genau hier setzt ein humanistisches, bindungsorientiertes pädagogisches Verständnis an – und damit auch die Gewaltfreie Kommunikation.
Die BBC Prison Study: Wenn Macht nicht automatisch brutal macht
Ein besonders spannendes Gegenbeispiel ist die sogenannte BBC Prison Study von Alex Haslam und Steve Reicher aus dem Jahr 2001.
Das Setting war dem Stanford-Experiment ähnlich: Es gab eine künstliche Gefängnisumgebung, Wärter und Gefangene. Diesmal aber wurde das Ganze von einer Ethikkommission begleitet, die sicherstellen sollte, dass keine massiven Grenzverletzungen stattfinden. Außerdem wurde sehr genau dokumentiert, was gesagt und gemacht wurde.
Die BBC hat die Studie damals auch medial begleitet. Die offizielle Seite zur Studie findest du hier:
👉 https://www.bbcprisonstudy.org
Und was passierte?
Kurz gesagt: nicht das, was Zimbardo prognostiziert hätte.
Die Wärter entwickelten keine starke „Wir gegen sie“-Identität und wurden nicht automatisch brutal. Im Gegenteil: Sie begannen, mit den Gefangenen zu kooperieren, Essen zu teilen, Karten zu spielen und gemeinsam abzuhängen. Die Dynamik war so wenig dramatisch, dass die Studie schließlich vorzeitig beendet wurde – nicht wegen eskalierender Gewalt, sondern, weil es einfach nichts „Fernsehtaugliches“ mehr gab.
Die Forscher kamen zu dem Schluss: Tyrannei ist keine unausweichliche Folge von Gruppenzugehörigkeit oder Machtunterschieden. Sie entsteht dann, wenn Menschen aktiv in eine Ideologie hineingeführt werden, die Unterdrückung rechtfertigt – und wenn Führungspersonen genau dieses Verhalten vorleben und belohnen.
Das ist eine völlig andere Botschaft als die, die Zimbardos Experiment vermittelt hat.
Warum das Stanford-Experiment kritisch neu bewertet werden sollte
Angesichts dieser Erkenntnisse gibt es inzwischen immer lautere Forderungen, das Stanford-Experiment aus Lehrbüchern zu entfernen oder zumindest viel kritischer darzustellen.
Mehrere Punkte sprechen dafür:
-
Methodische Schwächen: kleine Stichprobe, starke Rollenvorgaben, fehlende Kontrolle, keine klare Trennung von Forschung und Inszenierung.
-
Massive Einflussnahme: Zimbardo war nicht neutral, sondern gestaltete das Setting aktiv mit und verschob die Grenzen immer weiter.
-
Selektive Darstellung: Dramatische Szenen wurden hervorgehoben, anderes Material kaum gezeigt.
-
Problematisches Menschenbild: Das Experiment wird häufig genutzt, um ein sehr pessimistisches Bild vom Menschen zu stützen, ohne alternative Daten gleichwertig zu erwähnen.
Vor allem aber manifestiert das Experiment immer wieder ein uraltes, defizitäres Menschenbild.
Natürlich gibt es Gründe, warum Menschen grausame Dinge tun. Es gibt Systeme, Ideologien, Traumata, Machtstrukturen und viele weitere Faktoren, die Gewalt begünstigen. (Das wird Thema eines anderen Newsletters oder Artikels – auch sehr spannend.)
Doch die These, die Zimbardo da aufgeworfen hat – dass wir quasi automatisch zu Tätern werden, sobald wir nur ein bisschen Macht bekommen – ist so nicht zu halten. Sie widerspricht einem humanistischen Weltbild und dem, was wir heute aus vielen Studien wissen.
Menschenbild und Erziehung: Wie unsere Sicht auf Kinder unser Handeln prägt
Was passiert, wenn wir Zimbardos Theorien glauben?
Dann prägt dieses Bild auch unser Verhalten.
So wie wir die Welt sehen, so begegnen wir anderen Menschen.
So sehen wir auch unsere Kinder.
Und entsprechend verhalten wir uns.
Wenn wir tief in uns glauben, dass Menschen im Kern egoistisch, gefährlich und machthungrig sind, werden wir schneller kontrollieren, bestrafen, misstrauen. Dann wird Pädagogik zum „Bändigen“ und „Zurechtrücken“.
Wenn wir hingegen davon ausgehen, dass Menschen – inklusive uns selbst und unserer Kinder – Bedürfnisse haben, die gesehen werden wollen, und dass Verhalten oft ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse ist, dann entsteht eine völlig andere Haltung. Dann fragen wir nicht: „Wie breche ich den Willen meines Kindes?“, sondern:
„Was braucht mein Kind (und was brauche ich), damit es wieder kooperieren kann?“
Dieses Menschenbild ist keine naive Romantik, sondern wird von vielen neueren Forschungsergebnissen unterstützt: Kinder sind von Anfang an auf Beziehung, Kooperation und Resonanz angelegt. Sie werden aggressiv, wenn sie überfordert, verletzt, in die Ecke gedrängt oder dauerhaft nicht gesehen werden – nicht, weil sie „von Natur aus“ böse wären.
Gewaltfreie Kommunikation: Ein humanistisches Gegenmodell
In der Gewaltfreien Kommunikation sind wir fest in einem humanistischen Weltbild verankert, in dem wir die Würde eines jeden Menschen achten und ein Leben ohne Gewalt anstreben.
Wir gehen davon aus, dass Menschen gerne zum Wohlergehen anderer beitragen, wenn sie es freiwillig tun können und keine eigenen, dringenden Bedürfnisse dem im Weg stehen.
Das verändert alles:
-
Wie wir über Konflikte denken.
-
Wie wir auf Wut, Widerstand und Rückzug reagieren.
-
Wie wir Macht verstehen – als Verantwortung, nicht als Herrschaft.
-
Wie wir mit Kindern sprechen und welche Botschaft sie über sich selbst und die Welt mitnehmen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Gewaltfreie Kommunikation dazu beitragen kann, die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. (Hier findest du mehr über die Gewaltfreie Kommunikation von mir.)
Vor allem aber kann sie helfen, die Verbindung zu uns selbst und zu unseren Kindern zu stärken – jenseits von Angst, Kontrolle und einem Menschenbild, das uns alle klein macht.
Und vielleicht ist genau das die wichtigste Lehre aus all den Debatten um das Stanford-Experiment:
Nicht jedes spektakuläre Experiment sagt die Wahrheit über den Menschen.
Aber unser Menschenbild entscheidet jeden Tag darüber, wie wir miteinander leben – und wie unsere Kinder aufwachsen.
:::
Wenn du bereit bist: Hiermit kannst du schon heute ganz unkompliziert starten!
👉 31-Tage-Challenge für ein friedliches Familienleben
Das bekommst du in der 31-Tage-Challenge:
-
Täglich einen kurzen Videoimpuls von nur 3 Minuten, der dich inspiriert.
-
Eine einfache Aufgabe, die sich direkt und unkompliziert in deinen Alltag integrieren lässt.
-
Tipps und Ideen, die dich unterstützen, Schritt für Schritt mehr Gelassenheit, Freude und Verbundenheit in deiner Familie zu erleben.
-
Nachhaltige Veränderung durch das Prinzip der kleinen Schritte: Jeden Tag ein wenig und doch mit großer Wirkung.
Hier geht es zur 31-Tage-Challenge
👉Für Eltern mit Wutzwergen unter 6 Jahren!
Mit dem Wutworkbook bekommst du nicht nur ein tiefes Verständnis für die Wut deines Kindes, sondern weißt auch, was du tun musst, um deinen Kind zu helfen mit seiner Wut.
Mit zusätzlichen Videotutorials für mehr Verständnis und Checklisten für einen leichteren Umgang mit Wutausbrüchen.
👉Explosives Verhalten bei Kindern
verstehen und lösen! Für Eltern von Kindern ab 6 Jahren
Dieser Kurs richtet sich speziell an Eltern von Kindern ab 6 Jahren, die jenseits der Autonomiephase oft in herausfordernde emotionale Situationen geraten.
Wenn dein Kind regelmäßig explodiert, Dinge kaputt macht oder andere Menschen haut, weißt du, wie schwierig und belastend das sein kann.
In dem Kurs lernst du einen Weg, der auf Verständnis und Liebe basiert, damit du dein Kind unterstützen und gleichzeitig eure Bindung stärken kannst.
Mit ganz konkreten Konfliktlösungsdialogen, die Orientierung bieten.
Zum Kurs “Explosives Verhalten bei Kindern verstehen und lösen.”